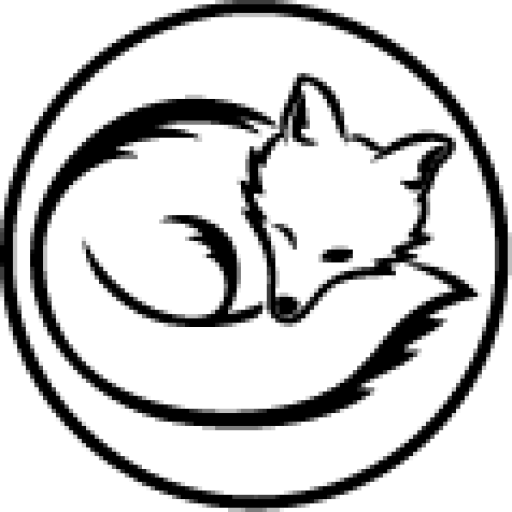Kollektive Arbeits-Strukturen: Noch ein Versuch
Nine to Five ist aus der Mode, so viel ist klar. Und dennoch ist die Kritik an den Versprechungen der bedürfnisorientierten, freischaffenden, ich-agierenden und ungezwungenen Arbeitsweisen groß. Dann geht es um Selbstausbeutung, Selbstoptimierung, neoliberale Korruption, Hypokrisie, kein richtiges Arbeiten im Falschen; kurz: alte Feinde in neuen Sneakern. Begriffe wie „flache Hierarchien“, „diverses Team“, „kreative Selbstentfaltung“ sind längst zu belächelten Schlagwörter heuchlerischer Start-Ups geworden und erneut stellt sich eine Generation die Frage, ob man ihr jetzt Scheiße als Gold verkauft hat oder ob es doch Grund zur Hoffnung gibt.
Soweit zum diskursiven Hintergrundgeräusch, bevor wir auf die Backstage des Fuchsbaus blicken, dass sich gegen Zynismus und für den Versuch kollektiver Arbeitsstrukturen entschieden hat. Widmete sich das Festival im Jahr 2022 der Frage (und Kritik) der vom Kapitalismus geprägte Zeitwahrnehmung, war es dem Team natürlich ein Anliegen aus der Kritik in die Praxis zu gehen und Arbeitsstrukturen zu entwickeln, die physisch und psychisch gesünder, bedürfnisorientiert und gemeinschaftlich sind. Große Worte, was steckt dahinter?
Meiner persönlichen Beobachtung als Teil des künstlerischen Leitungsteams des Projektes „Nach:Denkmal“, die ich im Mai 2022 angetreten und damit ein relativ spätes Teammitglied wurde, konnte ich folgende Abgrenzung zu konventionelleren Arbeitgeber_innen entnehmen: Da gab es zum einen die obligatorische Postulation der nicht-existenten oder zumindest flachen Hierarchien: Der Möglichkeit jegliche Kritik in einem wöchentlichen Teamtreffen zu veräußern und die persönliche emotionale, professionelle und gesundheitliche Verfasstheit in einer Begrüßungsrunde zu kommunizieren. Dann hatte man die Freelancer-Freiheit zu arbeiten, wann man will – an welchen Wochentagen, welchen Tages- und Nachtzeiten; so schnell oder langsam, wie man eben konnte. Damit kam eine verhältnismäßig große Flexibilität, die Abweichungen der Produktivitätsmaxime, in Fällen von psychischen und physischen Kapazitätsmangel erlauben sollten. Dies wurde durch das generell, tendenziell freundschaftliche Verhältnis der Teammitglieder untereinander verstärkt, das die Empathie vergrößert und die Hilfsbereitschaft steigert.
Das klingt jetzt alles recht technisch; wenn man es ein bisschen besser verkaufen wollen würde, klänge es so: Du organisierst mit deinen Freunden ein Festival, kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst; zoomst von Paris nach New York, Ghana und Berlin, um ein arsch geiles Festival irgendwo bei Hannover zu organisieren, an das alle glauben und auf das alle extrem viel Bock haben. Es wird für dich gesorgt, allen ist wichtig, dass es dir gut geht. Wenn man nun aber doch kritisch auf die ganze Sachen blicken wollen würde, müsste man wohl folgendes sagen:
Das mit den Hierarchien, die es nicht gibt, ist eine schöne Idee, aber (und das wird die wenigsten vom Hocker hauen), in Praxis leider seltenst der Fall. Da gibt es verschiedene Erfahrungswerte, verschiedene Charaktere und verschieden gelagertes Durchsetzungsvermögen. Ähnlich ist es mit dem Arbeiten wann man will; denn Fakt bleibt: Die Arbeit muss gemacht werden, die Kompetenzen sind meist nicht übertragbar und zeitliche Imperative können sich auch einstellen, ohne dass das Team danach fragt. Gerade zu den späteren Zeitpunkten von Projektarbeit, stellt sich die Frage was wirklich gewonnen ist, wenn man nicht von neun bis fünf, sondern von elf bis neun arbeitet. Schließlich die Freunde im Team: Dass Werte wie Rücksichtnahme, Solidarität und Hilfsbereitschaft groß geschrieben werden ist zwar eine schöne Sache, aber erstens keine institutionalisierte Garantie und zweitens auch kein neu erfundenes Rad, dass auch bei konventionellen Arbeitgeber_innen mehr oder weniger gegeben ist: In der doch etwas verbindlicheren Form der Arbeitnehmerrechte. Aber im Grunde, ist das nichtmal der Hauptpunkt. Denn wenn es um die Verhandlung von Arbeitsformen geht, hängt sich mein Skeptizismus (gerade in der Kultur) vor allem an folgender Problematik auf: Arbeit muss halt gemacht werden, und ob die genaue Arbeitszeit jetzt verhandelbar ist oder nicht; ob man auf eigene Verantwortung oder per Krankmeldung zuhause bleibt, ist mehr oder weniger egal, wenn sich niemand aus dem Team von dieser Arbeit allein finanzieren kann. Man kann da ja nicht für alle sprechen, aber ich persönlich würde unausgesprochene Hierarchien sofort für ein Gehalt eintauschen, von dem ich meine Miete und Lebensmittel für den Monat zahlen kann. Und auch die flexiblen Arbeitszeiten bekommen einen bitteren Beigeschmack wenn sie vor allem gut dafür sind, sich flexibel um seinen zweiten Brotjob zu arrangieren – es sei denn natürlich, die elterliche Brieftasche ist in der Lage für den Kulturjob aufzukommen; dann kann man vielleicht auch noch ein bisschen studieren, nebenbei, und nochmal bei Bourdieu nachlesen, wieso die Kulturindustrie so eine magere (Klassen)diversität aufweist.
Richtig perfide aber wird es, wenn die prekäre Bezahlung sich aus Förderungen speisen, denen genau sowas wichtig ist: Neue Arbeitsweisen, bitte, dokumentieren, bitte, alternativen zu kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen, bitte, und nachweisen, dass man Fortschritte macht, bitte, durch die Arbeitskultur. Dann kann man sich auf die Schultern klopfen und sich daran erfreuen, wie progressiv das alles ist, bevor man seine Eltern anruft und sie um das Zahlen der Gasrechnung bittet – oder einfach friert.
Vita
Nora Haddada, geboren 1998 in Neunkirchen (Saar), studierte Kreatives Schreiben und Literaturwissenschaft in Hildesheim, Paris und zuletzt in Berlin. Sie arbeitete unter anderem als Drehbuchautorin, Vertretung in der Deutschen Botschaft Paris oder Agentin in der Agentur Petra Eggers. Veröffentlichung in Zeitschriften und Anthologien, Einladungen auf Konferenzen und Festivals. Zuletzt im Missy Magazin, dem „Insert Female Artist Festival“ und der Bella Triste. Sie lebt in Berlin.